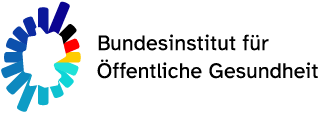Psychische Folgen von Übergewicht bei Kindern – was du wissen solltest
Übergewicht kann nicht nur den Körper belasten, sondern auch die Seele. Viele Kinder mit Übergewicht erleben Ausgrenzung, Scham oder Selbstzweifel. Hier erfährst du, welche psychischen Folgen Übergewicht haben kann und wie du dein Kind stärken kannst.


Die Expertin zum Thema
Prof. Dr. Christine Joisten
Fachärztin für Allgemeinmedizin, ärztliche Psychotherapeutin, Sportmedizin und Ernährungsmedizin sowie Hochschullehrerin an der Deutschen Sporthochschule Köln
Wenn das Gewicht die Seele belastet
Wenn Kinder übergewichtig sind, bekommen sie das oft früh zu spüren – nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Vielleicht machen sich andere lustig. Vielleicht traut sich dein Kind nicht mehr in die Sportstunde. Vielleicht zieht es sich zurück. All das sind keine Einzelfälle und viele Eltern erleben ähnliche Situationen.
Der AOK-Kindergesundheitsatlas 2024 zeigt: 83 Prozent der Eltern von Kindern mit schwerem Übergewicht bzw. Adipositas machen sich Sorgen, dass ihr Kind langfristig körperlich, aber auch seelisch beeinträchtigt sein könnte. 63 Prozent haben Angst vor sozialer Benachteiligung. “Viele Eltern kämpfen nicht nur mit dem Gewicht ihres Kindes, sondern auch mit einer großen inneren Unsicherheit: Was habe ich falsch gemacht?”, sagt Prof. Dr. Christine Joisten, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Sportmedizin und Ernährungsmedizin. “Doch Übergewicht entsteht nie durch eine einzelne Entscheidung – sondern immer durch viele kleine Faktoren, die zusammenspielen. Es geht nicht um Schuld, sondern um Verständnis und neue Wege.“
Was sind psychische Folgen von Übergewicht bei Kindern?
“Übergewicht wird oft rein körperlich betrachtet. Dabei kann es auch Ausdruck seelischer Belastung sein”, weiß Prof. Joisten. “Manche Kinder essen, um Stress, Einsamkeit oder Druck zu kompensieren. Andere entwickeln durch ihr Übergewicht in der Folge psychische Probleme.”
Übergewicht kann Kinder auf viele psychisch Arten belasten. Die Auswirkungen sind individuell unterschiedlich. Entscheidend ist dabei weniger das Gewicht selbst als die Art, wie Kinder sich fühlen und wie sie von anderen behandelt werden. Prof. Joisten erklärt: “Was oft übersehen wird: Kinder mit Übergewicht kämpfen nicht nur mit Blicken von anderen, sondern oft auch mit einem sehr harten inneren Blick auf sich selbst. Daher braucht es vor allem ein Gegenüber, das ihm zeigt, dass es wertvoll ist.“
Die folgenden seelischen Belastungen treten bei übergewichtigen Kindern besonders häufig auf:
Scham und Rückzug
Viele Kinder mit Übergewicht empfinden Scham. Nicht nur wegen ihres Körpers, sondern auch wegen vermeintlicher Schwächen – zum Beispiel, weil sie beim Sport langsamer sind. Sie nehmen sich selbst als anders wahr, vergleichen sich mit schlankeren Gleichaltrigen und glauben, nicht dazuzugehören.
Diese Scham kann dazu führen, dass sich Kinder aus dem sozialen Leben zurückziehen: Sie umgehen Geburtstagsfeiern, Ausflüge oder den Schwimmunterricht. Manche vermeiden enge Kleidung oder Situationen, in denen der Körper sichtbar ist. Besonders schmerzhaft ist es, wenn sie sich im eigenen Körper „falsch“ fühlen und kein Gegenüber haben, das ihnen den Druck nimmt.
Ein gestörtes Körperbild
Wenn ein Kind immer wieder vermittelt bekommt, sein Körper sei nicht „normal“ oder „schön“, kann sich ein gestörtes Körperbild entwickeln. Das bedeutet: Das Kind nimmt sich selbst in einem überkritischen, verzerrten Licht wahr. Es sieht sich als „zu dick“, „nicht gut genug“, „wertlos“. Dieses negative Selbstbild kann tief sitzen und sogar dann bestehen bleiben, wenn sich das Gewicht verändert.
Besonders gefährdet sind Jugendliche, weil sie in dieser Phase besonders sensibel auf soziale Bewertung reagieren, ihr Selbstwertgefühl stark von äußerer Anerkennung abhängig ist und sie häufiger vermeintlichen Schönheitsstandards durch Werbung, Social Media und Co ausgesetzt sind als jüngere Kinder.
Mobbing und Bodyshaming
Studien zeigen: Kinder mit Übergewicht oder Adipositas sind häufiger von Mobbing betroffen als andere Kinder. Das kann sich durch gemeine Spitznamen, abwertende Kommentare oder systematische Ausgrenzung äußern. Auch Blicke, Tuscheleien oder digitale Hänseleien in Chats oder sozialen Netzwerken gehören dazu.
Wenn die körperliche Erscheinung zur Zielscheibe wird, spricht man von Bodyshaming. Viele Kinder erleben das, nicht nur von Gleichaltrigen, sondern auch durch beiläufige Bemerkungen von Erwachsenen, Lehrern oder Ärzten. Selbst gut gemeinte Ratschläge können verletzen, wenn sie mit Schamgefühlen verbunden sind. “Kinder mit Übergewicht erleben oft, dass sie nicht nur ‚dicker‘, sondern auch anders oder weniger wertvoll behandelt werden”, sagt Prof. Joisten. “Das verletzt nicht nur, es kann sich tief in die Seele eingraben. Wir alle tragen Verantwortung dafür, wie wir über Körper bzw. Körperformen sprechen.”
Emotionales Essen
Nicht jedes Kind isst aus Hunger. Gerade wenn Langeweile, Stress, Überforderung oder Einsamkeit im Spiel sind, wird Essen oft zur Strategie, um sich kurzfristig besser zu fühlen. Dieses sogenannte emotionale Essen ist kein Ausdruck von Schwäche, sondern eine intuitive Reaktion auf belastende Gefühle.
Das Problem: Diese Art des Essens führt nicht zu echter Entlastung, sondern kann langfristig zu einem Kreislauf aus Frust, Schuld und weiterem Essen führen. Je mehr das Kind versucht, sich über das Essen zu beruhigen, desto mehr wächst der innere Druck, gerade wenn der Körper dann weiter zunimmt. Oft sprechen Kinder selbst nicht darüber. Umso wichtiger ist es, achtsam hinzusehen, welche Rolle das Essen im Alltag spielt – und wo eigentlich emotionale Bedürfnisse dahinterstecken.
Erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen
Übergewicht ist kein Auslöser, kann aber ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen sein. Kinder mit starkem Übergewicht bzw. Adipositas haben laut Studien eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an einer Depression oder einer Angststörung zu erkranken. Das liegt nicht am Gewicht allein, sondern an der ständigen Konfrontation mit Ablehnung, Scham oder dem Gefühl, nicht dazuzugehören.
Neben dem emotionalen Essen ist auch das Risiko für Essstörungen erhöht. Besonders häufig treten Binge-Eating-Störungen auf, bei denen es zu unkontrollierbaren Essanfällen kommt – meist gefolgt von Schuld- oder Ekelgefühlen. In einigen Fällen entwickeln betroffene Jugendliche auch Bulimie (Ess-Brech-Sucht) oder restriktive Essmuster, bei denen Mahlzeiten ganz ausgelassen werden.
Was du tun kannst – praktische Tipps für mehr seelische Stärke
- Sprich offen, aber sensibel
Frag dein Kind: „Wie fühlst du dich, wenn …?“ oder „Gibt es Momente, die dir schwerfallen?“ Hör zu, ohne zu werten. Alle Gefühle sind erlaubt. - Gib Orientierung im Alltag
Regelmäßige Mahlzeiten, Bewegung an der frischen Luft, weniger Bildschirmzeit – das tut Körper und Seele gut. Fang klein an. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Stabilität. - Sei ein Vorbild
Geh mit gutem Beispiel voran und lebe deinem Kind einen ausgewogenen, gesunden Lebensstil vor. - Achte auf deine Sprache
Vermeide Kommentare wie „Ich sehe dick aus“ oder „Das ist ungesund“, wenn du über dich selbst sprichst. Sag lieber: „Ich achte auf mich, damit ich mich wohlfühle.“ Dein Kind hört mit, auch wenn es gar nicht angesprochen ist. - Hol dir Unterstützung
Du musst das nicht allein schaffen. Ob Kinderarzt, Psychologe oder Gesundheitsberater: Es gibt viele Fachleute, die dir und deinem Kind medizinisch, emotional oder ganz praktisch helfen können.
“Kinder brauchen keine perfekten Eltern, die gibt es gar nicht”, sagt Prof. Joisten. “Sie brauchen solche, die sie sehen, verstehen und begleiten. Gerade beim Thema Gewicht ist es wichtig, dass Eltern nicht nur an Verhalten arbeiten, sondern auch an der Beziehung. Denn echte Veränderung beginnt dort, wo ein Kind spürt: Ich werde ernst genommen, so wie ich bin.”
Wo gibt es Hilfe, wenn mein Kind unter Übergewicht leidet?
Die AOK Rheinland/Hamburg unterstützt dich und dein Kind mit konkreten Angeboten:
- Clarimedis: Telefonische Beratung durch medizinisches Fachpersonal
- AOK-Kochkurse: Alltagsnahes Kochen für Familien – mit Spaß und Geschmack
- Patientenschulung bei Adipositas: Ganzjähriges Programm für Kinder und ihre Familien
Tipp: Auch Kinderärzte sind eine wichtige erste Anlaufstelle. Sie können einschätzen, ob psychologische Hilfe sinnvoll ist und euch gezielt weitervermitteln.

Du hast Fragen zu Übergewicht bei Kindern?
AOK-Clarimedis steht dir beratend zur Seite.
Unter 0800 1 265 265.
FAQ
Was sind psychische Folgen von Übergewicht bei Kindern?
Viele Kinder mit Übergewicht erleben Scham, Ausgrenzung, Selbstzweifel und ein negatives Körperbild. Auch emotionale Essmuster oder depressive Verstimmungen sind möglich.
Wie erkenne ich, ob mein Kind unter seinem Gewicht leidet?
Typische Anzeichen sind Rückzug, Vermeidungsverhalten (z. B. Sport), Grübeln über das Aussehen oder Essverhalten, emotionale Ausbrüche oder plötzliche Stimmungsschwankungen. Versuchen Sie, informiert zu bleiben, was Ihr Kind sich auch in den sozialen Medien anschaut.
Wie kann ich mein Kind emotional stärken?
Sprich offen, aber sensibel mit deinem Kind. Zeige Verständnis, ohne Druck aufzubauen. Achte auf deine Sprache, gib Orientierung im Alltag und hol dir frühzeitig Unterstützung.
Wo bekomme ich Hilfe bei psychischen Belastungen durch Übergewicht?
Anlaufstellen sind Kinderärzte, psychologische Beratungsstellen oder die AOK Rheinland/Hamburg – z. B. Patientenschulungen oder Clarimedis.
Wann sollte ich an eine Essstörung denken?
Wenn dein Kind heimlich isst, Mahlzeiten verweigert, stark über das Gewicht nachdenkt oder sich zurückzieht, kann eine Essstörung vorliegen. Lass dich ärztlich oder psychologisch beraten.